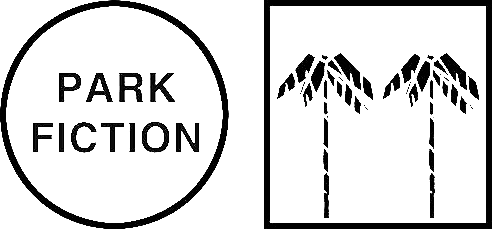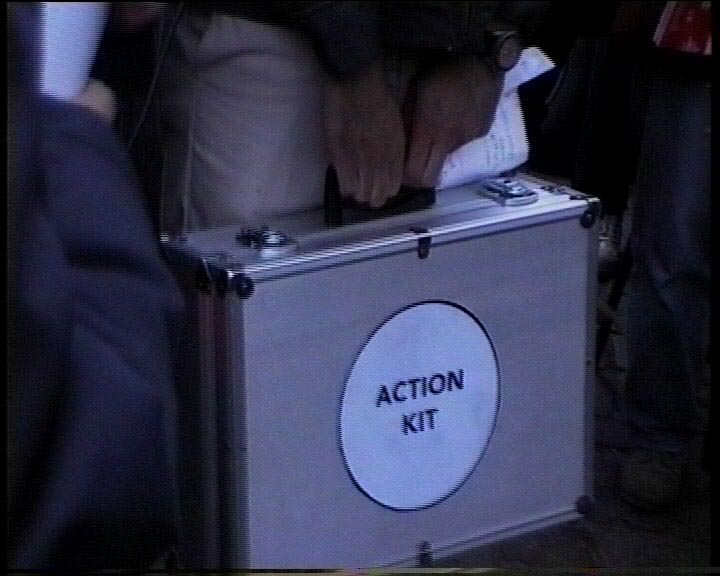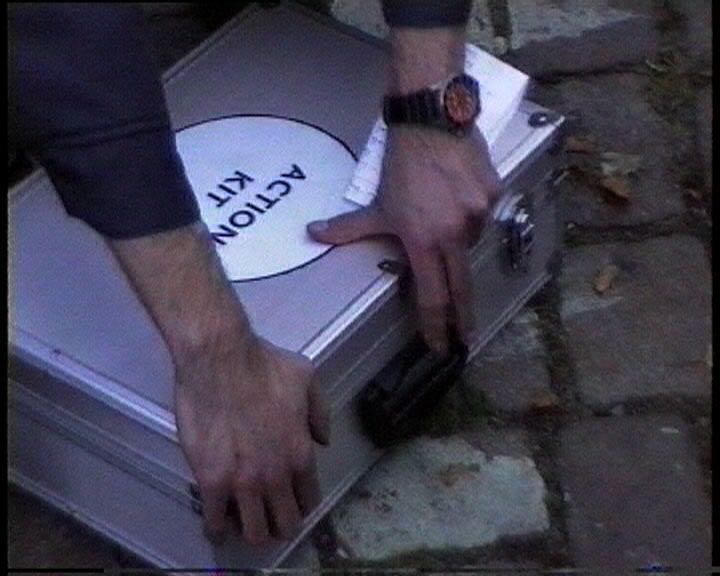Sanssoucis
Parks haben als Bezugspunkt das Paradies, die Gartenkunst schafft Orte des irdischen Vergnügens. Parks spiegeln die Ideale einer Epoche wieder, wie der englische Landschaftsgarten den aufgeklärten Humanismus aus der Zeit der bürgerlichen Revolutionen. Ob Alhambra, Berkeley People’s Park oder Bomarzo, ob Lunapark oder die Experimental Community Of Tomorrow in Disneyworld: Parks versprechen ein glückliches Leben befreit von der Arbeit, abseits des Alltags. Ein solches Versprechen aufgreifen, heißt auf St. Pauli, dem Stadtteil mit der ärmsten Wohnbevölkerung der westlichen BRD, eine subversive Forderung erheben. Schließlich versucht die herrschende Klasse genau diesen Menschen beizubringen, sich mit einem Leben im Elend abzufinden, ihre Ansprüche runterzuschrauben und den Gürtel enger zu schnallen, um mit dieser arm-aber-ehrlich-Propaganda die gigantischen Umverteilungsprozesse ideologisch zu überwölben. Die Forderung nach dem Park ist ein richtiger Schritt, um dieser Politik entgegenzutreten.
Wem gehört die Stadt ?
Park Fiction ist Kunst im öffentlichen Raum als praktische Kritik an Stadtplanung als Ausdruck und Mittel staatlicher Macht und wirtschaftlicher Interessen aus einer BenutzerInnenperspektive heraus.
Von vornherein war für den Hafenrandverein und die beteiligten KünstlerInnen klar, daß KünstlerInnen genausowenig ein Privileg auf die Gestaltung des öffentlichen Raums in Anspruch nehmen können, wie zugelassen werden kann, daß dieses Privileg wie selbstverständlich von Behörden und ArchitektInnen in Anspruch genommen wird. Zumal auf St.Pauli, das nicht nur mit dem schlauen Kampf um die besetzten Hafenstrassenhäuser auf eine feine Tradition sturer Unerbittlichkeit gegenüber dem staatlichen Kontrollanspruch über den städtischen Raum zurückblicken kann. Diese urbanen Praxen setzen wir im folgenden in Bezug zur Verstädterungsthese von Henri Lefèbvre:
Kritische Zone
In seinem Buch „Die Revolution der Städte“ / (La revolution urbaine, 1972) beschreibt Henri Lefèbvre eine Situation der Krise. Die Krise kennzeichnet die Phase des Übergangs der Industriegesellschaft zur verstädterten Gesellschaft. Lefèbvre zeigt Fluchtlinien, die aus dieser Krise weisen, zu einer neuen Form der Stadt. Denn dem Projekt der Verstädterung der Gesellschaft steht der nächste Quantensprung bevor.
0 – 100% Verstädterung
Dieser Begriff der Verstädterten Gesellschaft wird zunächst als korrekte Beschreibung der Entwicklungstendenz gegen andere, unzureichende Begriffe wie Freizeitgesellschaft oder Informationsgesellschaft abgegrenzt [weil solche Begriffe die Wirklichkeit auf isolierte, gerade hervorstechende Aspekte reduzieren]. Der Begriff der Verstädterten Gesellschaft ist deshalb die angemessene Beschreibung der derzeitigen Entwicklungstendenz, weil im Begriff „Stadt“ Gesellschaft, soziale Beziehungen, Dichte, Handel, Produktion, Kommunikation, Technik, Geschichte… und die Materialisierung all dieser Begriffe mitenthalten ist.
Elementarste Merkmale des städtischen Lebens sind: die Verschiedenheiten der Lebensweisen, die Verschiedenheiten der Verstädterungstypen, der kulturellen Modelle und Werte, die mit den Bedingungen und Schwankungen des Alltagslebens in Zusammenhang stehen.
Für uns wesentlich ist der Punkt: die Stadt ist der angeeignete Raum, der –Prozess der Verstädterung beschreibt einen Prozess der Aneignung.
Oben und unten unterscheiden
Lefèbvre unterteilt die Stadt in drei Ebenen [keine geographischen], und beschreibt damit eine Hierarchie: Die oberste Ebene [die globale Ebene G] ist die abstrakteste: die Ebene der institutionellen Macht, des Staates. Diese Einrichtungen sind – in Bezug auf ihre Bestimmung dessen, was Stadt ist, entweder Geschichte und überholt, wie etwa Kirche und Kirchenstaat oder das Modell ”politische Stadt” der Griechen, oder sie stehen dem städtischen Leben feindlich gegenüber. Für diese Institutionen ist Stadt nicht Ziel, sondern Mittel und Schauplatz von Interessen, die mit der Stadt im oben definierten Sinne nicht identisch sind. Insbesondere die Industrialisierung hat Städte hervorgebracht, die ganz und gar dem wirtschaftlichen Zweckrationalismus unterworfen sind. Die Stadt ist hier als Fabrik organisiert – wie die Städte des Ruhrgebiets oder Manchester wie es von Engels beschrieben wurde. Die Stadt fällt der Industrialisierung, der vom Staat [Ebene G] freie Hand gelassen wird, zum Opfer.
Heute geht dieser Prozess weiter, hat sich jedoch verfeinert. Die Entwicklung der Städte folgt der Entwicklung des Kapitals, sich neue Märkte außerhalb der eigentlichen Industrieproduktion zu erschließen und damit immer größere Bereiche des Lebens und der Städte der Logik der Profitmaximierung zu unterstellen. Ein einfaches Beispiel dafür: die Blockierung des Straßenraums durch die Ware Auto, die systematische Entwohnung der Innenstädte in den 60er und 70er Jahren, die Umwandlung ehemals öffentlichen Raums in von Privatunternehmen kontrollierte halböffentliche Zonen.
Aufruhr auf Ebene p
Die zweite Ebene M [Straßen, Plätze, öffentliche Gebäude wie Pfarrkirchen, Schulen usw.] liegt zwischen der Ebene G [Kathedralen, Museen, Autobahnen, Kasernen, Flughäfen, Monumente…] und der untersten , dritten Ebene p [wie privat], der Ebene des Wohnraums. Diese dritte Ebene ist es, in der zu unrecht etwas Geringfügiges gesehen wird. Jedoch genau diese Ebene ist es, der die Veränderung, die Revolution der Städte entspringt.
Ausführlich erörtert Lefèbvre, wer die Veränderung, die Überwindung der kritischen Zone nicht leisten kann – nicht einmal in der Lage ist, eine Prognose zu geben, in welche Richtung das gehen wird, und schon gar nicht in der Lage eine angemessene Praxis zu entwickeln: nicht die Soziologie, nicht die Architekten, und nicht die Stadtplanung, denn: ”die urbanistische Illusion ist eine Wolke am Berg, die den Weg versperrt”.
Vielmehr wird die Revolution der Städte vom Wohnraum ausgehen.
Stadt wird Subjekt
Auf diesem Gedanken, von Lefèbvre in den 70ern formuliert, baut Hoffmann-Axthelms Buch und Idee von der ”3. Stadt” auf. Kerngedanke ist: die Stadt muß vom Objekt zum Subjekt werden. Sie soll nicht mehr Gegenstand der Veränderung durch ihr feindlich gegenüberstehene Mächte sein [wie die oben genannten der globalen Ebene, wie in Hausmanns Paris das Militär, oder die funktionalistische Stadt in Bauhaus-Nachfolge], sondern Subjekt der Veränderung werden – also die Richtung aus sich heraus entwickeln und selbst zur Akteurin werden. Wie hat man sich das vorzustellen?
Die Revolution geht von der Wohnung aus
Lefèbvre interpretiert einen Satz Hölderlins: das ”menschliche Wesen” könne nur als Dichter leben. Die Beziehung des ”menschlichen Wesens” zur Welt, zur ”Natur”, zu seinen Begierden, zu seiner Körperlichkeit, hat ihren Ort im Wohnraum, realisiert sich dort und wird dort ablesbar. Es sei ihm unmöglich, etwas zu bauen, eine Bleibe zu haben in der es lebt, ohne etwas, das sich vom Alltag unterscheidet, das über es selbst hinausweist: seine Beziehung zum Möglichen wie zum Imaginären. Dieser Wunsch ist noch in der elendesten Hütte, noch in der tristesten Neubauwohnung in [zum Beispiel Kitsch- ] Objekten verkapselt. Also in Gegenständen mit genau den Qualitäten, die die Moderne den Gegenständen austreiben wollte.
Aus der Wohnung auf die Straße
Von diesen verkapselten Wünschen gehen also die Vektoren aus, Wegweiser die die Richtung zeigen, was der Satz meint: die Stadt wird zum Subjekt, die Umwälzung geht vom Wohnraum aus und bekommt von dort ihre Richtung. Aber – ist das nicht nur optimistische Spekulation, frommer Wunsch? Wo finden sich denn Anzeichen dafür, daß die Veränderung stattindet, der Quantensprung bevorsteht?
Der subjektive Faktor
Während Lefèbvre 1970 auf seiner Suche nach dem revolutionären Subjekt Nietzsche zitiert, übersieht er schlichtweg, daß Feministinnen zum selben Zeitpunkt das Private als politisch auf die Tagesordnung setzen, in Theorie und Praxis. Und nicht, um im Sinne von Gleichberechtigung, den öffentlichen, männlich bestimmten, globalen Normraum mit weiblichen Körpern zu füllen, sondern um ihn zu verändern.
Quantensprünge
Dann, Ende der 70er, bricht plötzlich und unvermutet eine Bewegung aus, die sich über fast alle Großstädte Europas ausbreitet, in der sich der Wunsch nach revolutionärer Veränderung, wortwörtlich vom Wohnraum ausgehend, vehement Geltung verschafft: die Bewegung der Hausbesetzungen.
Zu diesem Zeitpunkt herrscht großer Wohnungsleerstand aus Gründen der Immobilienspekulation – also auch hier wieder: die Blockierung des städtischen Lebens durch eine ihm feindlich gegenüberstehende Macht. Häuser stehen leer, die Stadt ist Gegenstand der Spekulation, also dem Interesse, Profit zu machen, unterworfen. Machtvoll meldet in dem Moment der Wohnraum seine Ansprüche an: vom Wunsch anders zu leben angetrieben, werden allein in Berlin über 200 Häuser besetzt, Prozesse der Aneignung in Gang gebracht, große Wohngemeinschaften gebildet, Kinderläden gegründet, Häuser bemalt und den veränderten Bedürfnissen entsprechend umgebaut, eigene Musik, Haarschnitte, Kleidung und Malstil entwickelt, das Leben auf andere Beine gestellt. Auf dem Höhepunkt der Kämpfe um die Hafenstrasse stehen die Barrikaden bis ins Rotlichtviertel, Radio Hafenstrasse sendet rund um die Uhr, die Stadt muss im Fall einer Räumung der tätowierten Häuser mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen rechnen. Und all das geht nicht aus Arbeitskämpfen hervor, wie noch die der Industrialisierung entsprechenden sozialen Bewegungen, sondern es wird – zwar an diese Kämpfe anknüpfend – vom Wunsch nach selbstbestimmtem Leben und Wohnen angetrieben.
Rekuperation
Hoffmann-Axthelm sieht das ebenso, als Vorschein der 3. Stadt, meint allerdings, aufgrund veränderter Bedingungen die Chancenlosigkeit einer Fortführung dieser Bewegung feststellen zu müssen. Die sich formulierende soziale Forderung nach Primat des Wohnraums über die globalen Mächte wurde wieder in die Wohnungen zurückgedrängt, vereinnahmt und als Lebensstil vermarktet. Allerdings zeigten sich hier die Konfliktlinien, und die Auseinandersetzungen setzen sich in anderer Form fort.
Maßlosigkeit zeigt Möglichkeit
Gerade auf St. Pauli erscheint in der Maßlosigkeit der Fassaden- und Vergnügungsgeschäftsgestaltung ein pervertierter Vorschein einer von den Leuten selbst gemachten Architektur, wird die Möglichkeit einer Stadt der vom Wohnraum ausgehenden Wünsche sichtbar. Nirgendwo sonst in diesem Land gibt es einen Stadtteil, in dem sich eine Klasse in diesem Maße Ausdruck verschafft, die ansonsten von jeglicher Gestaltung ausgeschlossen ist. Noch liegt die Gestaltung der Spielhallen, Discos, Striplokale und Kneipen, wie auch zahlreicher Fahrgeschäfte auf dem DOM in den Händen von Kleingewerbetreibenden, Halbkriminellen und Emporkömmlingen. Noch, weil vom staatlich sanktionierten Großprojekt am Millerntor ausgehend, im Zusammenspiel mit kleinteiliger operierenden Immobilienspekulanten und Systemgastronomen, die Situation sich dahingehend zu verändern droht, daß die Voraussetzungen für diese Gestaltungsfreiräume gefährdet sind. Nur durch breiten Widerstand konnte die Schließung von Hafenkrankenhaus und Astra-Brauerei verhindert werden, die ein Drittel der Fläche St. Pauli-Süds auf den Immobilienmarkt geworfen hätte.
Auch wenn die Gestaltungen auf St. Pauli als Ausdruck des reinen Warenscheins kritisiert werden können und hier Menschen, vor allem Frauen, so offensichtlich ausgebeutet und zur Ware degradiert werden, wie es sich in der zugeknöpften Hansestadt ansonsten nicht zeigt, ist trotzdem klar, daß St. Pauli ein Ort ist, an dem sich massenhafte Wünsche ausdrücken, die in der Stadt in die privaten vier Wände verbannt sind.
Und das hat etwas mit einem Gedanken Lefèbvres zu tun: daß der Wohnraum das Unbewusste der existierenden Stadt sei.
Öffentlichkeit
Dennoch ist damit nicht mehr gesagt, als daß es auf St. Pauli ästhetische Artikulationen von Begierden gibt, die dem homogenisierenden Zugriff staatlicher Planung und bürgerlicher Geschmacksvorstellungen noch gerade entkommen sind. Aber repräsentiert ist hier immer noch nur, wer ein Lokal besitzt oder gemietet hat, und die Motivation dieser ästhetischen Hervorbringungen ist meist kommerziell.
Was den Leuten die hier wohnen jedoch fehlt, ist kommerziell unbesetzter, öffentlicher Raum. Diese Tatsache hat zur Ablehnung des aktuellen B-Plans am Pinnasberg geführt und dazu, an derselben Stelle einen Park zu fordern.
Eine knappe Diskussion des Öffentlichkeitsbegriffs gehört an diese Stelle: der Hafenrandverein für selbstbestimmtes Leben und Wohnen in St. Pauli fordert einen von den AnwohnerInnen selbst geplanten Park. Damit ist eine Richtung angezeigt, die mit den vorngegangenen Übelegungen in Zusammenhang steht:
eine angeeignete Fläche steht im Gegensatz
1. zu dem ”neutralen”, öffentlich d.h. anonym gestalteten Staatsraum ebenso, wie
2. zu dem privatisierten Raum, der sich als öffentlicher Raum ausgibt, aber über die sich aus dem Privateigentum ergebenden Ausschlüsse funktioniert, über rassistisch oder ökonomisch motivierte Ausgrenzung von Personen, Beschränkungen von Handlungsmöglichkeiten, bzw. Motivation bestimmter Handlungen wie einkaufen, sitzen nicht liegen, essen, nicht betteln, nicht skaten…
[die im Zuge der Privatisierungswelle um sich greifenden private-public-partnerships vereinigen in sich die hässlichsten Eigenschaften beider Welten]
Eine Grünfläche oder das größte Wohnzimmer der Welt?
Die zuvor beschriebenen Kämpfe zwischen der globalen Ebene G und der Ebene p treten besonders auffällig auf der mittleren Ebene in Erscheinung, der Ebene also, auf der auch Kunst im öffentlichen Raum stattfindet, auf Plätzen, Straßen, in kleineren Institutionen, in Parks. Die Kunst im öffentlichen Raum steht damit vor der Entscheidung, Agentin welcher dieser beiden Anforderungen sie sein will.
Eine Möglichkeit, ein widerständiges Potential, ist insoweit gegeben, als der Kunst eine Restautonomie gegenüber Homogenisierungstendenzen zugestanden wird. Fraglich dabei ist, ob diese Widerständigkeit im Namen eines überkommenen Kunstbegriffs, der auf Vorstellungen einer privilegierten Künstlersubjektivität basiert, noch ohne weiteres beansprucht werden kann. Oder umgekehrt gesagt: eine solche Vorstellung schreibt vorhandene Ausschlüsse fest, und gerade die diesem Künstlerbild entstammenden Werke ließen sich in den Achtzigerjahren wieder als Repräsentationskunst im staatlich-wirtschaftlich-nationalen Interesse dienstbar machen.
Etwas besseres
Dem Planungsprozess geht eine kollektive Wunschproduktion im Stadtteil vorraus. Die verschiedenen Haltungen, Berufe und Handlungsfelder, die sich um den Durchsetzungs- und Planungsprozess des Parks herum treffen, durchkreuzen und infizieren sich gegenseitg. Das [autonome Künstler-] Subjekt geht in einer kollektiven Wunschproduktion und einem öffentlichen Planungsprozess auf. Über das gemeinsame Interesse und konkrete Ziel haben sich Allianzen zwischen Leuten mit unterschiedlichen Hintergründen aus verschiedensten Zusammenhängen hergestellt: politisierte AnwohnerInnen, soziale Trend-GastronomInnen, deregulierten LayouterInnen, Pastoren, HausbesetzerInnen, eine militante Köchin, hedonistische SozialarbeiterInnen, KioskbetreiberInnen, GeographiestudentInnen und Musikern der Pudelszene, also Leute aus jenem hedonistisch gelagerten Feld mit deuticher Nähe zum Sektor p, die ihre Aktivitäten hier in einen politisch/sozialen Zusammenhang stellen, aus dem sie zum Teil hervorgegangen sind. Die KünstlerInnen – wie auch die Landschaftsarchitektin – beteiligen sich also an einem laufenden Prozess, in dem wesentliche Ansprüche bereits formuliert sind, arbeiten also nicht unter der Bedingung eines durch staatliche Kunstinstitutionen erteilten Auftrags oder erteilter Freiheit, sondern als Mitglieder einer AnwohnerInneninitiative, die sich selbst ermächtigt hat, staatlicher Planung entgegenzutreten.
Park der Zugänglichkeit, Planungsprozess der Zugänglichkeit
Im Kunstbereich erarbeitetes Wissen, das eine Anschlussfähigkeit zu den hier aufgeworfenen Problemen besitzt, kann einen anderen, zusätzlichen Blickwinkel verschaffen und den Prozess radikalisieren. Vor allem geht es aber darum, Strategien zu entwickeln, einen Planunsprozess so zu gestalten, daß er für Leute, die aufgrund kultureller und gesellschaftlicher Vorkehrungen wie auch Lebenserfahrung, für gewöhnlich von der aktiven Gestaltung der Öffentlichkeit ausgeschlossen sind, zugänglich wird. Dafür lohnt es sich einen Blick auf jene Orte zu werfen an denen die privaten, kunstähnlichen Tätigkeiten stattfinden, um diesen einen Raum zu öffnen, der nicht als Hobby diskriminierend gerahmt ist.
Januar 98, Arbeitsgruppe Park Fiction
P.S.:
Kunstbetrieb !
Der Hafenrandverein arbeitet seit Jahren. Proteste gegen die Bebauung wurden bereits Anfang der 80er von der Kirchengemeinde St. Pauli geäußert, die Forderung nach dem Park erstmals Anfang der 90er gestellt, und der Anspruch: ein Park, von denen geplant, die ihn nutzen, brauchen, wollen – wurde im Hafenrandverein längst formuliert. Das sei hier nocheinmal erwähnt, weil es ablehnenswert ist, wenn KünstlerInnen als KommunikationsanregerInnen [InitiatorInnen] auftreten und sich dann das Konzept von anderen füllen lassen. Dieser hässliche Paradigmenwechsel ist ein Avantgardistentrick, mit dem sich KünstlerInnen pseudobescheiden vom Gestalterischen zurückziehen, tatsächlich aber im selben Zug eine andere, in einer kulturellen Hierarchie höher angeordnete Position einnehmen. Diese Partizipationskunstwerke scheinen dazu da zu sein, die allgemeine Untätigkeit und Passivität aufzunehmen und als leere Handlung zu reproduzieren.