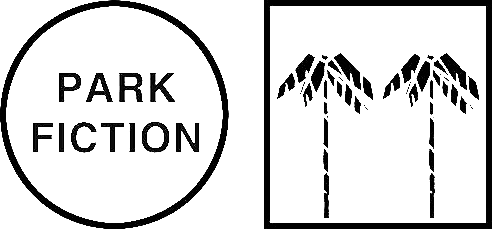Wünschen im Wolkenbügel
Jetzt sollen diese Diskussionen im Park einen festen Ort erhalten: das „Institut für unabhängigen Urbanismus“. Anika Heusermann sprach mit Christoph Schäfer von Park Fiction über die Pläne für das Institut und über Perspektiven, die sich aus dem Kongress ergeben haben.ak: Ein erster Teil des Parks am Elbhang ist in den letzten Monaten fertiggeworden. Weitere Bauabschnitte folgen in den nächsten Jahren. Auf dem Parkgelände, im Schauermannspark, ist die Aufbockung des Park Fiction-Planungscontainers vorgesehen, von Euch oft als „Wolkenbügel“ bezeichnet. Der Container soll künftig das bereits auf der Documenta11 gezeigte Park Fiction-Archiv sowie ein „Institut für Urbanismus“ enthalten. Kannst Du Genaueres über dieses Vorhaben sagen?
Christoph Schäfer: Dem Park ist ja in all seiner Schönheit nicht unbedingt in jeder Faser anzusehen, welcher Konflikt der Realisierung vorausgegangen ist. Bei Park Fiction ging es zwar um ein reales Stück Stadt, aber eben nicht nur, sondern um eine grundsätzliche Infragestellung von Planungsprozessen, Entscheidungsstrukturen und der Definition von Stadt durch die herrschenden Mächte. Diese Auseinandersetzung sollte sichtbar bleiben: Das Archiv ist für uns eine Form, wie ein sozialer Prozess, an dem wir selbst teilgenommen haben, erinnerbar gehalten werden kann und produktiv bleibt. Von dem Archiv sollen weitere Forschungen und Experimente im urbanen Raum ausgehen, aber auf dem Boden der Erfahrungen und des Netzwerks von Park Fiction, also im Kontext der damit verbundenen Realisierungsandrohung.
Worin wird sich Euer Institut von einem universitären Institut unterscheiden? Die Universität Hamburg betreibt z.B. im Fachbereich Ethnologie und Volkskunde das interdisziplinäre Forschungsprojekt Stadt.
Bei uns braucht man keinen Schulabschluss, kriegt kein Bafög, keine Noten und kann seine Aufgabe völlig selbst bestimmen. Grundlegend ist das Interesse, aus einer Alltagsperspektive heraus zu arbeiten, vom bewohnten, benutzten Raum auszugehen, also Forschung nicht davon abgetrennt zu betreiben, und weitere Experimente zu entwickeln. Es geht um Sachen, die nach außen gehen, wie z.B. die Ausstellung der Documenta-Installation auf der Reeperbahn, die praktisch auf der Strasse stand, und wo die Park Fiction Guides, Jugendliche aus St. Pauli, Führungen durch die Ausstellung und zum Park gemacht haben und Christine vom Schwabinggradballett nebenbei mit denen Kurzgeschichten geschrieben hat. Andere haben bei dem – doch ziemlich spezialisierten – Kongress gearbeitet. Dort gab es, vielleicht erstmals, eine Führung der internationalen Kongressgäste durch die Hafenstrasse, eine durch die Flora, ein Essen in der St. Pauli Kirchengemeinde und eins im Stadtteilkulturzentrum. Uns ist wichtig, dass Leute aus unterschiedlichen kulturellen Sphären sich mindestens sehen können und voneinander wissen, was sie tun, und sich im besten Fall gegenseitig schlauer machen.
Auf der anderen Seite: Worin wird sich Euer Institut von einem Stadtteilarchiv unterscheiden?
Ich finde Stadtteilarchive eigentlich eine gute Idee, außer dass sie sich auf den Stadtteil beschränken, bzw. im Namen so etwas mitschwingt wie „Stadtteilidentität“ als etwas festgeschriebenes – dagegen bin ich fast so sehr wie gegen „Nationale Identität“. Im Gegensatz dazu geht Park Fiction davon aus, dass ein lokales Netzwerk immer wieder neu geschaffen, neu erfunden werden muss, und – wenn man den Begriff der Identität überhaupt verwenden will – diese durch gemeinsames Handeln entsteht. Wir arbeiten lieber mit Begriffen wie „lokales Wissen“ – wobei da eben der „globale Austausch“ dazu gehört. Es ist ja kein städtischer Quadratmeter irgendwo auf der Welt mehr vorstellbar, in dem sich nicht das Globale wiederfindet, die Stadt ist nicht mehr ohne das Außen, das darin enthaltene Fremde, denkbar. Und es ist, glaube ich, schwieriger, die Klassengrenze zu einer NachbarIn zu überschreiten, als mit Leuten in anderen Ländern zu sprechen, die die selben Bücher gelesen haben. Im Vorfeld der Konferenz stellte sich zum Beispiel raus, dass zwei unserer 12jährigen Guides zuhause Bollywoodvideos sammeln, während die indischen ReferentInnen den Top Ten Hit von Panjabi MC nicht kannten. Ein Forschungsthema könnte zum Beispiel sein: gibt es eine spezielle Aufnahmefähigkeit oder Austauschfähigkeit für fremde Musikstile in Hafenstädten? Und das in Surabaya, Kalkutta, Hongkong, Hamburg und der Karibik zu untersuchen, das mit MusikerInnen diskutieren, Sendungen draus zu machen – in der Art.
Zum „Wolkenbügel“: Der Name geht ja zurück auf einen Entwurf des russischen Konstruktivisten El Lissitzky, der auch aktiv an der Oktoberrevolution teilnahm. Der „Wolkenbügel“ (von 1924) war als Antithese zum amerikanischen Skyscraper, DEM Symbol des Kapitalismus, gedacht. Ein hochgestelzter Flachbau, der sich in der Betonung der Horizontalen deutlich vom senkrecht aufstrebenden Wolkenkratzer abgrenzen sollte. Du hast mal geschrieben, dass Du sofort Fan dieses Entwurfs warst. Warum?
Für mich ist das eine fliegende Wohnung. Diese Idee von der Arbeiterklasse, die sich nicht mehr von der Schwerkraft besiegen und niederdrücken lässt, das finde ich sehr schön daran. Aber wenn wir das mit so einem kleinen Container machen auf zwei Meter Höhe und das Institut nennen, drückt es einen gebrochen utopischen Bezug zu den dominanten Verhältnissen aus: eine fliegende Wohnung, die auf Stelzen steht. Das Politische ist ja nicht in den Bau selbst eingeschrieben. Ich hatte darüber mal eine Unterhaltung mit Michael Lingner, so 1991/92, für den das ein Beispiel war für Kunst, die Funktionalität hat. Und ich fand es dafür eigentlich ein recht schlechtes Beispiel. Denn wenn man den Bau aus dem Kontext rausnimmt, kann er auch für etwas ganz anderes stehen. Mal angenommen, es wäre damals in Moskau gebaut worden und jetzt würde die Deutsche Bank oben einziehen, dann würde das in der ganzen Wirkung total auf dem Kopf stehen. Das wäre so eine sichere Etage, abgelöst vom Boden. Genau das ist Mitte der 90er Jahre eingetreten, als die Erbauer des Potsdamer Platzes dort eine „Info-Box“ installierten, die nichts anderes war als eine ganz plumpe Version des Wolkenbügels, und die als spektakuläres Partizipationsangebot für den drumherum sich vollziehenden, autoritärsten Planungsprozess der Nachkriegszeit fungierte. Ich finde, diese Umkehr zeigt, dass man bestimmte Dinge mit Formen allein gar nicht schaffen kann, sondern nur durch die soziale und politische Funktion, die so ein Gerät erfüllt.
Als ersten Auftakt zum Institut habt Ihr Ende Juni den Kongress „Unlikely Encounters in Urban Space“ organisiert. Dort habt Ihr u.a. den Begriff der „konstituierenden Praxen“ ins Spiel gebracht. Was ist damit gemeint?
Einerseits, dass man sich nicht auf die Konfrontation mit dem Staat fokussiert. Aber es heißt auch, und das ist viel wichtiger, sich davon abzugrenzen, den Weg zu gehen, den man als Reformmöglichkeit immer angeboten kriegt. Das würde heißen, dass konstituierende Praxis immer auch ein Gegenstück ist zum Parteiengründen oder zum Als-Bürger-Eingaben-Machen, also sich an den vorgeschriebenen Ablauf der Dinge zu halten. Bei konstituierenden Praxen geht es um das Moment der autonomen Setzung und des parallelen Arbeitens, was dann früher oder später in Konflikt gerät. Aber die Idee ist nicht der frontale Angriff auf den Staat.
Kannst Du an einem Beispiel konkret machen, was konstituierendes Arbeiten gerade auch im Hinblick auf Stadtkritik bedeutet? Das Institut zielt ja auf einen „unabhängigen Urbanismus“?
Zur Zeit wird ja Stadt auf „Wirtschaftsstandort“ reduziert, während klassischerweise und offiziell Stadt und Staat homogen zusammen gedacht werden. Ich glaube aber, mit Lefebvre, dass das zwei völlig unterschiedliche Sachen und Logiken sind, der staatliche Normraum und das Urbane als die verdichtete Unterschiedlichkeit. Maclovio Rojas, die wir zum Kongress eingeladen hatten, ist eine Stadt in der Stadt Tijuana. (vgl. ak 476) Vom Staat völlig unabhängig hat es u.a. eigene Schulen, PressesprecherInnen, einen eigenen Stadtplaner; Es betriebt das einzige Frauenhaus in Tijuana und – bezugnehmend zu den Zapatistas – ein Aguascalientes Zentrum. Darüber hinaus ist ein Zentrum für Theorie und politische Philosophie geplant. Maclovio macht eine clevere Netzwerkpolitik mit KünstlerInnen vor allem aus den USA, linken Gruppen, aber auch den Quakern zum Beispiel, und konnte deshalb bisher von der Regierung nicht geräumt werden. Auch wenn diese Stadt aus Not und unter extrem prekären, gar nicht mit hier vergleichbaren Bedingungen entstanden ist, ist sie trotzdem ein Beispiel, dass Städte auch ohne und gegen mächtige Investoren entstehen und anders funktionieren können.
Welche Rolle spielen künstlerische Formen in so einer politischen Praxis?
In der Kunst geht es ja prinzipiell und idealerweise um Unterschiedlichkeit – die zugespitzt statt auf Konsens abgeschliffen wird. Dieser in der Kunst geübte Umgang mit und Respekt vor Unterschiedlichkeiten und die damit verbundene Neugier, finde ich Eigenschaften, die wichtig sind, wenn heute Leute aus sehr verschiedenen Hintergründen und Kulturen zusammen agieren wollen. Aber auch taktisch können künstlerische Verfahren von Vorteil sein: so ist es zum Beispiel dem Schwabinggradballett gelungen, während des Grenzcamps stundenlang in der Straßburger Innenstadt ein didaktisches Theaterstück aufzuführen, obwohl die Stadt mit einem kompletten Demonstrationsverbot belegt war, und schließlich, als das Ballett von der CRS, einer besonders skrupellosen französischen Polizeieinheit, umstellt war, durch Songs einen Volksauflauf herzustellen und dadurch Verhandlungen und freien Abzug zu erzwingen.
Was hat der Kongress über den Austausch konkreter Strategien hinaus an Perspektiven für das Institut gebracht?
Was fast alle Gruppen auf dem Kongress verbindet, ist die Idee, aus einem Alltagsblick und aus Alltagspraxen heraus sowohl seine Theorie als auch die anderen Praxen zu entwickeln. Also die Frage, wie kommt man sowohl von einem Theorie-von-oben-Blick weg, als auch von einem Kunst-getrennt-vom-Alltag Blick. Wie wird man das los? Aber nicht im Sinne von Utopien vergessen und sich nur noch um das Alltagsleben kümmern. Sondern eher so wie bei Sarai (2), wo dieses Herauslesen aus dem Alltag ja extrem betrieben wird. Allein dass Sarai ihren Reader „The Cities of Everydaylife“ genannt haben, besagt das schon. Die Bücher haben deshalb auch so ein bisschen Bibelcharakter für mich. Das Cybermohallah-Projekt von Sarai z.B. finde ich nicht nur aus taktischen Gründen wichtig, sondern vor allem deshalb, weil der Rezeption ein extrem hohes Maß an gestaltender Kraft zugemessen wird, also dem Lesen und Beschreiben der Stadt: Das Compughar (Computerhaus) ist ein selbstregulierendes Laboratorium, das von Sarai in einem illegal errichteten Viertel Delhis betrieben wird, in dem die jungen BewohnerInnen Microtexte schreiben, die genau die Städte des Alltags beschreiben und decodieren, die auf den offiziellen Karten gar nicht vorkommen und die ständig vom Abriss bedroht sind. In diesen hochpräzisen und poetischen Beschreibungen, eigentlich die Literatur der Megastädte, werden diese Viertel auf einer zweiten Ebene sichtbar gemacht. Und damit wird aus einem der machtfernsten Medien, der Poesie, ein Element der konstituierenden Macht der Multitude. Dieses Arbeiten auf einer mikroskopischen Ebene und diesen Ernst der Mikropolitik bei Sarai, dieser Versuch, dass keiner mehr instrumentalisiert wird, das finde ich sehr wichtig. Auch für das Institut.
Interview: Anika Heusermann
Anmerkungen
1) Information zum Kongress unter: www.parkfiction.org/unlikelyencounters/index.php
2) Sarai ist ein Medienlabor und Experimentierfeld für digitale kollektive Arbeit in Delhi, in dem Forschung über urbane Kultur und Politik, Medienpraxis und Aktivismus ineinander fließen. Weitere Infos: www.sarai.net